ANALYSE / WIRTSCHAFT IN OSTDEUTSCHLAND
In den Plänen des Bunds für Kraftwerke und Wasserstoffnetze kommt die Lausitz bisher kaum vor. Dabei braucht die Region jetzt dringend eine entschlossene Energiepolitik. Diese fünf Punkte sind besonders wichtig.
Von Christine Keilholz
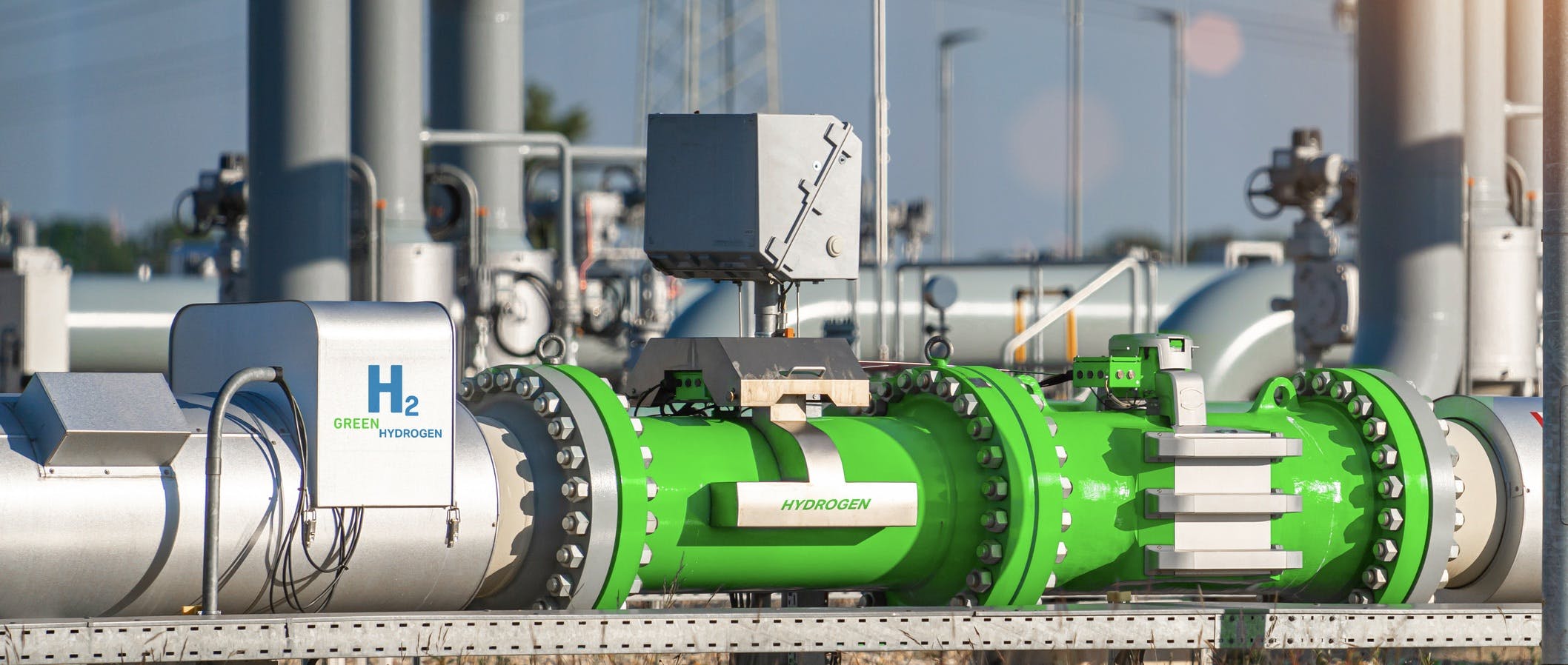
Bezahlbare Energiepreise für alle Unternehmen
Die Industrie leidet unter hohen Energiepreisen. In die energieintensiven Branchen wird laut über die Verlagerung von Standorten ins Ausland nachgedacht. Das schürt die Angst vor massenweisem Arbeitsplatzverlust und Deindustrialisierung. „Was in anderen EU-Ländern mit dem Industriestrompreis geht, muss auch bei uns gehen“, fordert Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) vom Bund.
Die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen geraten dabei ins Abseits. Diese Unternehmen machen mehr als 90 Prozent der Lausitzer Wirtschaft aus. Zu Recht fordern Ostdeutschlands Unternehmerverbände deshalb gleiche Bedingungen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen: „Hohe Energiepreise gehören zu den größten Standortrisiken für ostdeutsche Unternehmen“, heißt es in einem Positionspapier, das die Verbände vor dem heute beginnenden Energieforum in Leipzig verfasst haben.
Das gilt insbesondere für die vielen kleinen Betriebe mit höchstens 50 Mitarbeitern, die Investitionen von langer Hand planen müssen. Zumal die Industrie andere Möglichkeiten hat, Energie zu generieren. Die BASF in Schwarzheide betreibt seit zwei Jahren einen Solarpark auf eigenem Gelände. Der bestreitet inzwischen mehr als zehn Prozent dessen, was der Standort verbraucht.
Anschluss ans Kraftwerks- und Gasnetz
Natürlich braucht die Lausitz eine Energiepolitik, die die Lausitz in den Mittelpunkt rückt. Das ist im Moment nicht der Fall. Die aktuellen Pläne der Bundesregierung für Kraftwerke und Netze nehmen die Energieregion nicht ernst. Ein Blick auf die Wasserstoff-Karte zeigt, dass das größte Revier im Osten so gut wie gar nicht vorkommt. Von den drei Kohlekraftwerken der Lausitz – einst die größten der DDR – ist im geplanten Wasserstoff-Kernnetz nur Schwarze Pumpe als Endpunkt einer Leitung auszumachen. So gesehen, hat die Lausitz keinen einzigen gesicherten Standort.
Für die Lausitz ist das bitter. Die Eigenwerbung als Boomregion hat bundesweit wenig Widerhall gefunden. Nur da, wo die Autobahn des Wasserstoffs Halt macht, ist eine bedeutende industrielle Entwicklung zu erwarten. Die Wasserstoff-Pläne des Bunds stufen die Lausitz als ostdeutsche Region ein, die aufgrund geringer Bevölkerung wirtschaftlich keine große Rolle spielen kann. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kam erst vorbei, als sie in Bayern schon die regionalen Schwerpunkte ihres Kraftwerksbaus kundgetan hatte.
Damit darf sich die regionale Politik nicht zufriedengeben. Eine Netzinfrastruktur, die nur Großverbraucher berücksichtigt, ist für die Lausitz nicht tragbar. Damit wird eine Region mit Potenzial praktisch abgeschrieben. Bund und Länder müssen dringend darauf hinwirken, dass Leitungen und Anschlussstellen kommen.
Keine Abstriche beim Wasserstoff
Seit Regierungswechsel in Berlin stehen die Farben des Wasserstoffs wieder zur Debatte. Grüner Wasserstoff, lange Zeit der Goldstandard der Energiewende, soll nach Willen der Bundesregierung nicht mehr zwingend erforderlich sein. Stattdessen wird die Farbpalette erweitert um blau – also um Wasserstoff, der aus fossilen Rohstoffen in Kombination mit CO2-Speicherung entsteht.
Vom blauen Wasserstoff verspricht sich das Bundeswirtschaftsministerium mehr Dynamik beim Hochlauf – der bislang eher enttäuschend läuft. Auch Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, äußerte sich jüngst in Cottbus so. Sein Credo: Lieber blauen Wasserstoff als leere Netze.
Aber blau ist eben fossil. Das führt nicht nur die Klimaziele ad absurdum. Es macht auch Investitionen zunichte, die es in der Wasserstoffwirtschaft bereits gibt. Unternehmen wie Hy2Gen in Drewitz oder das RefLau in Schwarze Pumpe haben ihre Geschäftsmodelle auf Dekarbonisierung ausgerichtet. Eine Politik, die Planungssicherheit bieten will, darf hier nicht einknicken vor einer zu schweren Aufgabe, sondern muss auf Kurs bleiben.
Klares Bekenntnis zu den Erneuerbaren
Energiewende ist nicht gerade das Lieblingswort der ostdeutschen Länderchefs. Das hat seinen Grund. Viele Menschen auf dem Land sind skeptisch, ob ihnen Wind und Solar sichere Energie verschaffen kann. Viele sehen die Transformation der Energiewirtschaft als einen langen und aufwendigen Prozess, der sie am Ende schlechter dastehen lässt. Das zeigt der Lausitz-Monitor, der entsprechende Daten abgefragt hat: Der Strukturwandel findet Zuspruch da, wo er mit Geld und Investitionen verbunden ist. Aber weniger Anklang, wenn es um Erneuerbare geht.
Dass sich das in fünf Jahren Strukturwandel nicht geändert hat, liegt auch am Lavieren der Politik. Die Parteien wissen immer noch nicht, ob sie sich für oder gegen den Kohleausstieg positionieren sollen. Am liebsten sprechen sie gar nicht darüber. Oder sie betonen Zurückhaltung durch Argumente der Versorgungssicherheit oder das Festhalten am Ausstiegspfad bis 2038 – auf das etwa die SPD-BSW-Regierung Brandenburgs in ihrem Koalitionsvertrag dringt.
Ein solches Lavieren kann sich die verantwortliche Politik nicht mehr leisten. Längst tobt auf dem Land Kulturkampf ums Windrad, angeheizt von Populisten, die sich als Beschützer der Heimat aufspielen. In den meisten Kommunalparlamenten der Lausitz sind kaum noch Mehrheiten für Energieprojekte möglich. Die müssen aber jetzt kommen, damit die Lausitz ihre Industrien halten kann. Solche Blockaden können dauerhaft Entwicklung behindern. Politik muss hier überzeugen und sich klar bekennen zum Langzeitprojekt Energiewende, das allen viel abverlangt aber auch Zukunft sichert. Sie hat damit auch die Wirtschaft auf ihrer Seite, die ihrerseits die „Versorgungssicherheit mit Erneuerbaren Energien als Standortfaktor“ versteht. Auch das steht im Positionspapier der Unternehmerverbände.
Energiewende verträglich machen
Gleichwohl braucht der Ausbau der Erneuerbaren mehr Steuerung und klare Regeln. Immer noch sehen zu viele Menschen die Energiewende als ein ideologisches Projekt, mit dem sich grüne Klimapolitiker durchgesetzt haben. Allerdings wird es mit CDU und SPD kein Roll Back zur Kohle geben. Wirtschaftsministerin Reiche will lediglich Tempo und Ambition drosseln. Ihr kürzlich erschienenes Energiewende-Monitoring geht zwar von weniger Strom- und Wasserstoffbedarf aus. Dennoch wird die Notwendigkeit der Erneuerbaren nicht bestritten.
Eins ist allerdings deutlich geworden nach fünf Jahren Strukturwandel: Die Energiewende braucht ein neues Narrativ. Bisher ist es nicht gelungen, den Menschen auf dem Land klarzumachen, was sie von alledem haben. In der Energieregion Lausitz wird die Energiewende in der Breite als Wirtschaftsabbau aufgefasst. Das ist falsch. Der einstige Kohlekonzern Leag investiert massiv in Wind und Solar. Die Beteiligung an Energieprojekten bringt Geld in kommunale Kassen. Die Forschung an erneuerbaren Technologien hat der Lausitzer Wirtschaft Hunderte von qualifizierten Jobs verschafft. Und nicht zuletzt: Große Industrieprojekte wird es künftig nur noch da geben, wo es auch Erneuerbare gibt.
Ja, die Folgen für Landschaft und Landwirtschaft müssen mehr berücksichtigt werden. Ja, die Bürger müssen besser in Projekte einbezogen werden. Trotzdem ist der Ausbau der Erneuerbaren die momentan beste Energiegewinnung, die sauber und klimaverträglich ist und uns unabhängig von ausländischen Mächten macht. Die Energiewende ist die vielleicht größte Umverteilung von öffentlichem Geld aus der Stadt aufs Land. Sie verschafft Dörfern einen wirtschaftlichen Aufschwung, ohne dass dafür die Luft verpestet, Bäche vergiftet oder Häuser abgebaggert werden.